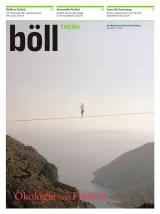Gerechtigkeit handelt davon, wie Gesellschaften aussehen sollen und was Menschen tun sollen. Materielle Verteilungsfragen sind davon nur ein Teilbereich. Ein zentrales Gerechtigkeitsprinzip ist die menschenrechtliche Freiheit. Aber inwiefern kann man Freiheit – ethisch und rechtlich – als Nachhaltigkeitsprinzip deuten, wenn man Nachhaltigkeit anspruchsvoll als das Erfordernis dauerhaft und global durchhaltbarer Lebens- und Wirtschaftsweisen versteht? Gemeint ist damit, Freiheit nicht mehr aufs Hier und Heute zu beschränken – und zudem die Voraussetzungen von Freiheit stärker mitzubedenken. Salopp könnte man auch von einer «ökologischen» Interpretation der Menschenrechte sprechen, denn raum- und zeitübergreifende Gefährdungslagen sind vor allem solche aus dem Umweltschutzbereich.
Umweltschutz als Freiheitsvoraussetzung
Menschenrechte sind Rechte auf Selbstbestimmung respektive auf Freiheit und auf elementare Freiheitsvoraussetzungen. Rechtlich und moralisch kommt das Recht auf die elementaren Freiheitsvoraussetzungen Leben, Gesundheit und Existenzminimum als zentrale Begründung des Umweltschutzes in Betracht. Existenzminimum sind beispielsweise Nahrung und Wasser. Beides wird etwa durch den Klimawandel wenigstens in Teilen der Welt potenziell prekär. Existenzminimum sind auch ein hinreichend stabiles Klima, atembare Luft, hinreichend stabile Ökosysteme. Solche Freiheitsvoraussetzungsrechte sind nicht immer ausdrücklich in völker-, europa- und nationalrechtlichen Menschenrechtserklärungen aufgeführt. Deshalb haben sie es oft schwerer mit ihrer Anerkennung als die klassischen bürgerlich-politischen Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- oder Eigentumsfreiheit. Doch ergeben diese ohne die Freiheitsvoraussetzungsrechte keinen Sinn. Denn Freiheit gibt es nur, wenn auch deren elementare Voraussetzungen wie Nahrung, Wasser, ein stabiles Globalklima, Frieden oder schlicht Leben und Gesundheit garantiert sind.
Umweltbezogene Menschenrechte haben nur dann eine Chance, wenn man einsieht, dass nicht nur direkte staatliche Gewalt freiheitsgefährdend ist, auf die die Menschenrechtsdebatte seit 300 Jahren als abzuwehrendes Übel schaut, sondern auch fehlender staatlicher Schutz gegen die Mitmenschen. Umweltzerstörung geht nämlich nicht primär direkt vom Staat aus, sondern von uns allen, also von den Mitmenschen. Und es sind noch weitere Einsichten für eine menschenrechtliche Umweltschutzbegründung nötig, die im Rechts- und Moraldiskurs nicht allgegenwärtig sind: So drohen Schäden für die Menschenrechte oft über Grenzen und über lange Zeiträume hinweg, und da Menschenrechte dort schützen, wo die Freiheitsgefahr droht, ist ein Umweltschutz auch in Fällen großer räumlicher Distanz geboten. Die Menschenrechte der Bangladescher gebieten den Europäern also weniger Klimaemissionen. Ebenso tun dies mit der gleichen Begründung die Menschenrechte unserer vielleicht noch ungeborenen Enkel.
Schwierig und praktisch entscheidend ist jedoch die Frage, welches Gewicht der damit dargelegte grenzüberschreitende und intergenerationelle Freiheitsvoraussetzungsschutz in Abwägung mit kollidierenden Menschenrechten wie etwa den Garantien zugunsten von Unternehmen und Konsumenten hier und heute hat. Hier kommt die Politik ins Spiel: Gerichte können einen Rahmen setzen, also aufgrund der Menschenrechte etwa vorgeben, dass demokratische und administrative Entscheidungen nicht zu einseitig gefällt werden und eine korrekte Tatsachengrundlage haben, dass also etwa der Klimawandel und die Ernährungslage realistisch eingeschätzt werden. Innerhalb dieses – auch noch näher beschreibbaren – Rahmens muss jedoch die Politik die nötigen Abwägungen treffen. Prozedural abgesichert wird all dies durch gewaltenteilig-demokratische Institutionen, deren Rechtfertigung seinerseits aus dem Freiheitsgedanken folgt, da sie der Freiheit dienlich sind. Die Einhaltung der Abwägungsregeln wird dabei von nationalen und transnationalen Verfassungsgerichten überwacht. Hier zeigt sich etwas Wesentliches: Auch möglicherweise universale Werte können durchaus untereinander abgewogen werden – sie gelten also nicht ausnahmslos und absolut. Und es gibt große politisch-demokratische Spielräume trotz der Menschenrechte, auch für die Frage nach dem richtigen Maß an Umweltschutz. Juristisch ist das trivial, da jede Menschenrechtserklärung ausdrücklich die Abwägungen vorsieht, im Alltag ist das aber vielen nicht klar.
Man könnte freilich fragen: Warum sollte die Freiheit einschließlich des Schutzes der elementaren Freiheitsvoraussetzungen als Norm universal verbindlich sein? Und warum kann man nicht beliebig weitere Prinzipien mit ganz anderem Inhalt danebensetzen? Die juristische Antwort hierauf lautet: Weil nahezu alle Staaten der Welt die globalen Menschenrechtsverträge unterschrieben haben. Man kann aber auch philosophisch-ethisch rechtfertigen, warum die Freiheit die normative Zentralidee sein muss und allein über eine sichere Grundlage verfügt, weswegen sich alles auf sie rückbeziehen muss. Wenn das so stimmt, dann hätte man zugleich gezeigt, dass das bisher aus Rechtssicht Gesagte auch philosophisch zwingend ist. Es ergäbe sich also eine Parallelität von philosophischer und juristischer Perspektive.
Nachhaltigkeit diskursethisch begründet
Die philosophische Argumentation für die Freiheit könnte, kurz gesagt, wie folgt laufen: In einer pluralistischen Welt ist der Streit über normative Fragen unvermeidlich. Dabei nutzen wir die menschliche Sprache – selbst Familienpatriarchen oder gar Diktatoren können das zumindest nicht vollständig vermeiden. Wer aber mit Gründen und ergo rational, also mit Worten wie «weil, da, deshalb» streitet, setzt logisch, ob er will oder nicht, etwas voraus: nämlich dass die möglichen Gesprächspartner – also auch räumlich und zeitlich entfernt lebende Menschen – gleiche unparteiische Achtung verdienen. Denn Gründe sind das Gegenteil von Gewalt und Herabsetzung. Und sie sind egalitär und richten sich an Individuen mit geistiger Autonomie, denn ohne Autonomie kann man keine Gründe prüfen. Damit aber gelangt man zur Achtung vor der Autonomie der Individuen (Menschenwürde) und zu einer gewissen Unabhängigkeit von Sonderperspektiven (Unparteilichkeit) als universalen Gerechtigkeitsprinzipien. Und die Freiheit – und mit ihr dann eben Freiheitsvoraussetzungen, Abwägungsregeln und gewaltenteilig-demokratische Institutionen – folgt just aus diesen Prinzipien. Deshalb ist die einerseits universale, andererseits breite Abwägungsspielräume belassende Freiheit auch für die demokratische Mehrheit verbindlich.
Ein nachhaltiger, also auch von künftigen Generationen und von allen Menschen weltweit so praktizierbarer Lebensstil wird Autofahrten, Fleischkonsum, schlecht gedämmte Häuser, Urlaubsflüge usw. voraussichtlich teurer und seltener werden lassen. Eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft muss natürlich das zum Leben Notwendige, Rechtsgleichheit und reale Entfaltungschancen für alle garantieren – sie garantiert aber keine materielle Gleichverteilung. Eine solche Festlegung auf Gleichverteilung widerspräche den erwähnten Abwägungsspielräumen. Deswegen kann auch nicht jedwede soziale Verteilungswirkung etwa von Klimapolitik beanstandet werden (sowohl rechtlich als auch philosophisch); auch ohne Umweltschutz kann sich nicht jeder jedweden Wohlstand leisten. Zwar garantieren liberale Gesellschaften Selbstbestimmung; dabei müssen aber die Wirkungen auf die Freiheit anderer mitbedacht werden.
Der Treibhausgasausstoß muss in absehbarer Zeit massiv verringert werden, will man nicht das System der Freiheit insgesamt gefährden.
Verteilungsgleichheit ist, anders als Rechtsgleichheit, also eigentlich kein freiheitlich-demokratisches Grundgebot, weil aus dem erheblichen Spielraum der Abwägungsregeln keine so kleinteilige Vorgabe an den Gesetzgeber abgeleitet werden kann. Dennoch überzeugt im Falle des Klimawandels menschenrechtlich der Gedanke, dass man (in etwa) zu einer globalen Pro-Kopf-Gleichverteilung der Emissionen kommen muss. Dieses «gleiche Existenzminimum» bedeutet zweierlei: Es muss dauerhaft jeder ein Mindestmaß an Energie zur Verfügung haben und an Landnutzung betreiben können (zumindest Letztere wird auch in Zukunft voraussichtlich nie ganz treibhausgasfrei möglich sein). Und gleichzeitig müssen alle, denn auch dies ist elementar, vor einem Klimawandel möglichst geschützt werden. Dies erzwingt schrittweise weitgehende Beschränkungen der Begüterten, die teils technisch, manchmal aber auch nur durch Verhaltensänderungen möglich sind. Denn der Treibhausgasausstoß muss in absehbarer Zeit massiv verringert werden, will man nicht das System der Freiheit insgesamt gefährden, und gleichzeitig ist jeder Mensch auf die Freisetzung wenigstens einer gewissen Menge von Treibhausgasen zwingend angewiesen – und dies macht es zumindest naheliegend, mit Ungleichheiten bei der Verteilung vorsichtig zu sein. Ebenso wichtig erscheint eine Ableitung aus dem Verursacherprinzip: Bei einem öffentlichen Gut wie dem Klima kann niemand für sich reklamieren, dass er eine «Leistung» in Ausübung seiner Freiheit zur Erzeugung dieses Gutes vollbracht habe.
Prof. Dr. Felix Ekardt leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und lehrt Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock.
Zum Weiterlesen: Ekardt, Felix: Theorie der Nachhaltigkeit. Rechtliche, ethische und politische Zugänge – am Beispiel von Klimawandel, Ressourcenknappheit und Welthandel, 4. Aufl., Baden-Baden 2015; Sustainability – Transformation, Governance, Ethics, Law, 2. Aufl. 2024; Postfossile Freiheit – Warum Demokratie, Umweltschutz, Wohlstand und Frieden nur gemeinsam gelingen, 2025.